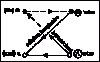Vorab eine Erklärung zum gelöschten IS-Thread:
Die von mir gestellte Frage bezog sich natürlich nicht auf eine religiöse Bewertung des Wahhabismus, sondern auf eine wissenschaftliche Bewertung seines Selbstanspruchs, den ursprünglichen Islam aus der Zeit des ersten Kalifen (aus wahhabistischer Sicht der "wahre Islam") eins-zu-eins abzubilden. Das müsste aus dem Kontext der Fragestellung eigentlich unmissverständlich hervorgehen. Ob dieser Selbstanspruch berechtigt ist, diese Frage ist so religionsgeschichtlich, wie es eine Frage nur sein kann. Jeder, der über ausreichende islamgeschichtliche Kenntnisse verfügt, kann darauf eine Antwort geben. In der Islamwissenschaft, aber auch in der Politik und allgemein bei allen Interessierten wird diese angesichts der politischen Lage durchaus dringliche Frage diskutiert und unterschiedlich beantwortet (was ich im Thread am Schluss auch andeutete). Manche, wie die Islamwissenschaftlerin Natana J. DeLong-Bas, bejahen sie, andere verneinen sie, alle Kommentatoren argumentieren dabei wissenschaftlich, auch wenn sie in Einzelfällen eine eigene religiöse Position haben. Den Text des Threads hatte ich übrigens in erster Linie für ein anderes, explizit religionswissenschaftlich ausgerichtetes Internet-Forum geschrieben und dort ohne negative Nachwirkungen gepostet; ins GF hatte ich ihn nur zusätzlich gestellt.
++++
@Muspilli:
Danke für deine sehr kenntnisreichen Ausführungen über Kernberg, die ich im Detail noch verarbeiten muss. Ich plane mittelfristig einen Versuch, die OBTh religionspsychologisch auf theistische Systeme (poly und mono) anzuwenden als Alternative zu Freuds religionspsychologischen Ansatz, was meines Wissens bisher noch nicht geschehen ist. Reiks und Fromms Arbeiten auf diesem Gebiet haben mich dazu angeregt. Ich werde in diesem Zusammenhang auf deine psychoanalytische Kompetenz noch zurückkommen.
Mich würde auch interessieren, wie du Lacans Theorie im Detail siehst. Man wirft ihm ja vor, das Affekt-Thema vernachlässigt zu haben. Ich zitiere anschließend als mögliche Diskussionsbasis ein paar Passagen aus einem eigenen älteren Text über Lacan und verlinke am Schluss eine Passage aus dem´Dictionary of Lacanian Psychoanalysis´ (siehe dort unter ´Affekt´) von Dylan Evans sowie eine englischsprachige Seite über die Affekt-Frage bei Lacan. In einem weiteren Post (erforderlich wg. Textbegrenzung) zitiere ich einige Passagen über Lacanianisches Begehren und Phantasma.
++++
„Das Spiegelstadium“, so Lacan, „ ist ein Drama, dessen innere Spannung von der Unzulänglichkeit auf die Antizipation überspringt und für das an der lockenden Täuschung der räumlichen Identifikation festgehaltene Subjekt die Phantasmen ausheckt, die, ausgehend von einem zerstückelten Bild des Körpers, in einer Form enden, die wir in ihrer Ganzheit eine orthopädische nennen könnten, und in einem Panzer, der aufgenommen wird von einer wahnhaften Identität, deren starre Strukturen die ganze mentale Entwicklung des Subjekts bestimmen werden. So bringt der Bruch des Kreises von der Innenwelt zur Umwelt die unerschöpfliche Quadratur der Ich-Prüfungen hervor.“ Lacan spricht hier Klartext über die Fadenscheinigkeit und fundamentale Pathologie des imaginären Ich. Dieses Bewusstseins-Ich, das nur denkt, dass es denkt, bezeichnet er mit der französischen Form des reflexiven Ich als ‘moi’, im Unterschied zur unmittelbaren Ichform des ‘je’, dem Subjekt des Unbewussten, das symbolisch strukturiert ist. Diese terminologische Differenzierung indiziert die grundlegende Gespaltenheit des Individuums in ein bewusstes Subjekt, welches den Modus der eigenen Existenz vollständig verkennt, und ein unbewusstes, welches hinter dem Rücken des imaginären Subjekts das Spiel des Begehrens treibt. Darüber hinaus ist für das imaginäre moi die eigene Gespaltenheit konstitutiv: weit davon entfernt, eine quasi substantielle Einheit darzustellen, ist das moi ein komplexer psychischer Prozess der kontinuierlichen Reflexion, Verschmelzung und Dissoziation von Bildern, genauer gesagt, von Vorstellungen, die sämtlich um einen archimedischen Punkt kreisen, den Lacan mit Freud als ‘Ideal-Ich’ bezeichnet.
(...)
Die dem Imaginären eigene Potentialität des Destruktiven lässt sich aus der spiegelbildlichen Spaltung des Bewusstseins-Ich ableiten. Der antike Mythos vom Jüngling Narziss illustriert die Grundsituation vortrefflich: beim Trinken aus einer Quelle vom eigenen Spiegelbild fasziniert, treibt ihn die Sehnsucht nach dem Einssein mit dem geliebten Gegenüber in den Tod. Denn da die Verschmelzung mit dem idealen Spiegel-Selbst im Realen nicht gelingen kann, bleibt als Ausweg nur die Vernichtung beider. Aus der Ausgangssituation ergeben sich nämlich folgende logische Möglichkeiten: erstens die Verschmelzung von Selbst und Imago; dies ist im Realen nicht möglich; zweitens ein Ablassen von diesem Streben; dies widerspricht der soghaften Dynamik der Faszination, die den Jüngling irreversibel an die ideale Imago ausliefert; drittens der Tod des Narziss, um im Spiegel-Selbst fortzubestehen; auch hier widersteht das Reale, denn mit dem einen würde auch das andere vergehen; und viertens eben der Untergang beider, des Narziss und seines Spiegelbildes, als Konsequenz aus der irreversiblen Dynamik der Faszination und der realen Zusammengehörigkeit von Original und Spiegelbild. Die Zerrissenheit des Subjekts resultiert auf der imaginären Ebene aus diesen vier Momenten des Spiegelbildkonflikts.
(...)
Das mythische Modell der destruktiven Eigenliebe liefert die Grundstruktur des Zusammenspiels von Sehnsucht und Aggression, die in allen narzisstisch-imaginären Operationen anzutreffen ist. Das Spiegel-Selbst - ein narzisstisches Ideal-Ich mit den Attributen der Ganzheit und Kontinuität - erscheint unter zwei Aspekten, die schlechthin unvereinbar sind und als solche die unaufhebbare Spannung der imaginären Beziehung begründen: zum einen als Bürge der eigenen Identität - mehr noch: als diese Identität an sich; zum anderen als ein Fremdes, als ein im Realen unerreichbares Anderes, getrennt durch eine fundamentale Differenz, die jede Identifikation ausschließt. Auf diese Weise gelangt das Subjekt in eine prekäre Rivalität zum Ideal-Ich, welches doch, als Wunschbild narzisstischer Allmacht, seine Stabilität und Einheit gewährleisten soll. Das Ideal-Ich wird durch seinen absolutistischen Anspruch letztlich zur Quelle des Hasses, oder, unmetaphorisch formuliert: zu dessen konstitutiver Bedingung. Die aus der imaginären Situation notwendig resultierende Dialektik von Anziehung und Abstoßung führt so die Dimensionen der Begierde und des Hasses in die Subjektivität ein.
(...)
Der Eintritt in die Symbolische Ordnung
War beim primären Bedürfnis und dessen halluzinatorischem Erfüllungsmodus die unmittelbare Erfüllung - gleich ob real oder fiktiv - das eigentliche Triebziel, so differenziert sich dieses auf der höheren Stufe zu einem unbedingten Anspruch auf mütterliche Präsenz. Natürlich ist der Wunsch nach realer Bedürfnisbefriedigung immer noch die treibende Kraft hinter dieser komplexeren Struktur. Indes hat das Kind bereits einen größeren Teil der Umweltkomplexität kognitiv erfasst und seinem Bewusstseinshorizont assimiliert: es hat gelernt, die Präsenz der Bezugsperson von ihrer Absenz zu unterscheiden und durch anspruchssignalisierende Äußerungen einzufordern, und dies, sofern das Bedürfnis auftritt, in aller Unbedingtheit. Die in ihrer unbedingten Präsenz gewünschte Person wird zum Garanten der eigenen narzisstischen Unversehrtheit, zum Objekt eines Anspruchs auf liebevolle Zuwendung und so zum Spender einer doppelbödigen Liebe, die zunehmend imaginäre Züge trägt. Was sich der Unbedingtheit des Liebesanspruchs an die Mutter schließlich entgegenstellt und entgegenstellen muss, ist die Symbolische Ordnung, die den imaginären Absolutismus in eine dritte und noch höhere Struktur integriert: in die Dimension der symbolisch vermittelten Intersubjektivität, die conditio sine qua non der menschlichen Kulturevolution.
Als Medium dieser Vermittlung tritt, folgt man Lacan, der Vater in Funktion, er ist die Schaltstelle, an der das soziale Gesetz, ein gänzlich immaterielles Abstraktum, transformiert wird in psychische Struktur, in unbewusstes Subjekt-Sein. Nun entsteht endgültig jenes Subjekt, von dem Lacan behauptet, es sei, anders als das moi des schönen oder auch weniger schönen Selbstbetrugs, die eigentliche Quelle der subjektiven Aktivitäten. Um es gleich vorwegzunehmen: nicht der konkrete Vater ist per se der Initiator der kleinkindlichen Subjektbildung, denn er ist selbst nur ein historisches Produkt vorgängiger symbolischer Prozesse; als Repräsentant der väterlichen Funktion im ödipalen Dreieck vermag er aber die Position im intersubjektiven Netz einzunehmen, von der aus die Macht des Symbolischen auf den imaginären Absolutismus des Kindes negierend und strukturierend - in Lacans dramatischer Terminologie: kastrierend - einwirkt. Das Verhältnis des konkret-kontingenten Vaters zu seiner sozial vorgegebenen symbolischen Funktion kann mit einem wichtigen Ausdruck des Lacanschen Denkens als imaginäre Verdopplung der symbolischen Position verstanden werden.
lässt sich die Vaterfigur als die Instanz begreifen, welche den Strukturierungsprozess dynamisiert, so liefert die Sprache - im Sinne der langue Saussures - das strukturale und formale Moment dieses Prozesses, der zur unbewussten Subjektbildung führt.
Über den Effekt dieses Prozesses führt Lacan aus: „Die Sprachwirkung ist die ins Subjekt eingeführte Ursache. Vermöge dieser Wirkung ist dieses nicht Ursache seiner selbst; es trägt nur den Wurm der Ursache in sich, der es spaltet. Seine Ursache nämlich ist der Signifikant, ohne den kein Subjekt im Realen wäre.“ Was das unbewusste Subjekt also konstituiert, ist das System von Signifikanten und deren Differenzen rein in ihrer Formalität unter Absehung von jedem Signifikat - hier fließt Sausseres Synchroniedenken und Lévi-Strauss` Strukturbegriff ein -, welches von Lacan unter dem Begriff des Signifikanten vereinfachend subsumiert wird. Die fundamentale Bedeutsamkeit dieses Prozesses kann gar nicht überschätzt werden: „Dieses Erleiden, diese Passion des Signifikanten wird von da her zu einer neuen Dimension der Conditio humana: sofern nämlich nicht einfach der Mensch spricht, sondern Es in dem Menschen und durch den Menschen spricht; sofern seine Natur eingewoben ist in Wirkungen, in denen die Struktur der Sprache, zu deren Material er wird, wieder auftaucht, und sofern damit die Relation des Sprechens in ihm Resonanz findet, jenseits von allem, was dem Vorstellungsvermögen der Vorstellungspsychologie zugänglich ist.“
Der zuvor verwendete Term der Ursache (frz. cause) zeigt bereits, dass für Lacan der tiefste Seinsgrund der Subjektivität ineins fällt mit der symbolischen Struktur als reine Form; insofern man also dem unbewussten Subjekt - wenn schon nicht dem bewussten - Substanz zuschreiben wollte (eine Überlegung, die aufgrund der hier vertretenen Auffassung von der Irrigkeit des Substanzdenkens rein spielerisch ist), wäre diese gleichbedeutend mit der formalen Struktur des Sprachlichen. Für Lacan stellt sich jedoch die Frage, wie sich Subjektivität und Intersubjektivität gemeinsam denken lassen, ohne Subjektivität mit der symbolischen Ordnung vollständig identifizieren zu müssen. Seine Antwort indiziert eine seltsamen Status der Subjektivität, die zur differentiellen Signifikantenstruktur, die nunmehr die Form des Unbewussten ausmacht, in einem vexierbildartigen Verhältnis steht: das Subjekt hat die Seinsweise des Strukturalen und ist doch etwas anderes als dieses Strukturale, eine amorphe Kraft, die sich im Strukturalen nur äußert. In Lacans Worten: „Sprachwirkung darin, dass es aus diesem ursprünglichen Spalten [durch die strukturale Sprachordnung] entsteht, übersetzt das Subjekt eine signifikante Synchronie in jene ursprüngliche zeitliche Schwingung, die das konstituierende fading seiner Identifizierung darstellt.“ Dabei sind es die von Jakobson hervorgehobenen sprachlichen Operationen der Metapher und der Metonymie, in denen das Subjekt sich artikuliert und damit die synchrone, also zeitlose Struktur in zeitliches Dasein transformiert. So schreibt Lacan, dass „die [im vorletzten Zitat] zitierten Wirkungen wiedergefunden werden sollen in jenen Gesetzen, die den anderen ‘Schauplatz’ beherrschen, den Freud in bezug auf die Träume als Ort des Unbewussten bezeichnet hat, die Wirkungen, die offenbar werden auf der Ebene jener Kette aus materiell instabilen Elementen, die die Sprache konstituiert, und die determiniert sind durch jenes doppelte Spiel von Kombination und Substitution im Signifikanten nach den zwei Abhängen (versants), die das Signifikat erzeugen: Metonymie und Metapher, jene Wirkungen also, die bestimmt sind für die Einsetzung des Subjekts.“
Diese Struktur des menschlichen Unbewussten ergibt sich als Effekt einer spezifischen, der ödipalen Dynamik, die Freud mit seiner Theorie des Ödipuskomplexes vorgezeichnet hatte und die von Lacan noch radikaler ausformuliert wird. Die im Verlaufe der ödipalen Krise sich in den Vordergrund schiebenden Motive des Eltern-Kind-Dramas sind der Inzestwunsch gegenüber dem gegengeschlechtlichen Elternteil und der Wunsch nach dem Tod des Vaters, beides Bestrebungen, die dem Gesetz des Sozialen und damit dem Sozialen ‘an sich’ diametral zuwiderlaufen. Dieses Gesetz gründet ja gerade auf der Tabuisierung von Inzest und Vatermord, was Freud schon hinreichend erkannte und von Lévi-Strauss in seiner Verwandtschaftstheorie (in bezug auf das Inzestverbot) detailliert weitergedacht wurde. Beide Tabus sind konstitutiv für die Bildung und Reproduktion menschlicher Gemeinschaft: das Inzestverbot ist Quelle sozialer Strukturbildung und -kohärenz, das Tötungsverbot ist Garant einer verbindlichen moralischen Ordnung, die jedes Subjekt in das immaterielle Positionengefüge der Gemeinschaft einbindet. Erst die Unterwerfung unter das Gesetz konstituiert das Subjekt als „Unterworfenes“ vollständig.
Zum Thema ´Lacan und Affekte´ siehe:
http://www.turia.at/pdf/Evans_S27-38.pdf
What Does Lacan Say About… Affects? | LACANONLINE.COM
Die von mir gestellte Frage bezog sich natürlich nicht auf eine religiöse Bewertung des Wahhabismus, sondern auf eine wissenschaftliche Bewertung seines Selbstanspruchs, den ursprünglichen Islam aus der Zeit des ersten Kalifen (aus wahhabistischer Sicht der "wahre Islam") eins-zu-eins abzubilden. Das müsste aus dem Kontext der Fragestellung eigentlich unmissverständlich hervorgehen. Ob dieser Selbstanspruch berechtigt ist, diese Frage ist so religionsgeschichtlich, wie es eine Frage nur sein kann. Jeder, der über ausreichende islamgeschichtliche Kenntnisse verfügt, kann darauf eine Antwort geben. In der Islamwissenschaft, aber auch in der Politik und allgemein bei allen Interessierten wird diese angesichts der politischen Lage durchaus dringliche Frage diskutiert und unterschiedlich beantwortet (was ich im Thread am Schluss auch andeutete). Manche, wie die Islamwissenschaftlerin Natana J. DeLong-Bas, bejahen sie, andere verneinen sie, alle Kommentatoren argumentieren dabei wissenschaftlich, auch wenn sie in Einzelfällen eine eigene religiöse Position haben. Den Text des Threads hatte ich übrigens in erster Linie für ein anderes, explizit religionswissenschaftlich ausgerichtetes Internet-Forum geschrieben und dort ohne negative Nachwirkungen gepostet; ins GF hatte ich ihn nur zusätzlich gestellt.
++++
@Muspilli:
Danke für deine sehr kenntnisreichen Ausführungen über Kernberg, die ich im Detail noch verarbeiten muss. Ich plane mittelfristig einen Versuch, die OBTh religionspsychologisch auf theistische Systeme (poly und mono) anzuwenden als Alternative zu Freuds religionspsychologischen Ansatz, was meines Wissens bisher noch nicht geschehen ist. Reiks und Fromms Arbeiten auf diesem Gebiet haben mich dazu angeregt. Ich werde in diesem Zusammenhang auf deine psychoanalytische Kompetenz noch zurückkommen.
Mich würde auch interessieren, wie du Lacans Theorie im Detail siehst. Man wirft ihm ja vor, das Affekt-Thema vernachlässigt zu haben. Ich zitiere anschließend als mögliche Diskussionsbasis ein paar Passagen aus einem eigenen älteren Text über Lacan und verlinke am Schluss eine Passage aus dem´Dictionary of Lacanian Psychoanalysis´ (siehe dort unter ´Affekt´) von Dylan Evans sowie eine englischsprachige Seite über die Affekt-Frage bei Lacan. In einem weiteren Post (erforderlich wg. Textbegrenzung) zitiere ich einige Passagen über Lacanianisches Begehren und Phantasma.
++++
„Das Spiegelstadium“, so Lacan, „ ist ein Drama, dessen innere Spannung von der Unzulänglichkeit auf die Antizipation überspringt und für das an der lockenden Täuschung der räumlichen Identifikation festgehaltene Subjekt die Phantasmen ausheckt, die, ausgehend von einem zerstückelten Bild des Körpers, in einer Form enden, die wir in ihrer Ganzheit eine orthopädische nennen könnten, und in einem Panzer, der aufgenommen wird von einer wahnhaften Identität, deren starre Strukturen die ganze mentale Entwicklung des Subjekts bestimmen werden. So bringt der Bruch des Kreises von der Innenwelt zur Umwelt die unerschöpfliche Quadratur der Ich-Prüfungen hervor.“ Lacan spricht hier Klartext über die Fadenscheinigkeit und fundamentale Pathologie des imaginären Ich. Dieses Bewusstseins-Ich, das nur denkt, dass es denkt, bezeichnet er mit der französischen Form des reflexiven Ich als ‘moi’, im Unterschied zur unmittelbaren Ichform des ‘je’, dem Subjekt des Unbewussten, das symbolisch strukturiert ist. Diese terminologische Differenzierung indiziert die grundlegende Gespaltenheit des Individuums in ein bewusstes Subjekt, welches den Modus der eigenen Existenz vollständig verkennt, und ein unbewusstes, welches hinter dem Rücken des imaginären Subjekts das Spiel des Begehrens treibt. Darüber hinaus ist für das imaginäre moi die eigene Gespaltenheit konstitutiv: weit davon entfernt, eine quasi substantielle Einheit darzustellen, ist das moi ein komplexer psychischer Prozess der kontinuierlichen Reflexion, Verschmelzung und Dissoziation von Bildern, genauer gesagt, von Vorstellungen, die sämtlich um einen archimedischen Punkt kreisen, den Lacan mit Freud als ‘Ideal-Ich’ bezeichnet.
(...)
Die dem Imaginären eigene Potentialität des Destruktiven lässt sich aus der spiegelbildlichen Spaltung des Bewusstseins-Ich ableiten. Der antike Mythos vom Jüngling Narziss illustriert die Grundsituation vortrefflich: beim Trinken aus einer Quelle vom eigenen Spiegelbild fasziniert, treibt ihn die Sehnsucht nach dem Einssein mit dem geliebten Gegenüber in den Tod. Denn da die Verschmelzung mit dem idealen Spiegel-Selbst im Realen nicht gelingen kann, bleibt als Ausweg nur die Vernichtung beider. Aus der Ausgangssituation ergeben sich nämlich folgende logische Möglichkeiten: erstens die Verschmelzung von Selbst und Imago; dies ist im Realen nicht möglich; zweitens ein Ablassen von diesem Streben; dies widerspricht der soghaften Dynamik der Faszination, die den Jüngling irreversibel an die ideale Imago ausliefert; drittens der Tod des Narziss, um im Spiegel-Selbst fortzubestehen; auch hier widersteht das Reale, denn mit dem einen würde auch das andere vergehen; und viertens eben der Untergang beider, des Narziss und seines Spiegelbildes, als Konsequenz aus der irreversiblen Dynamik der Faszination und der realen Zusammengehörigkeit von Original und Spiegelbild. Die Zerrissenheit des Subjekts resultiert auf der imaginären Ebene aus diesen vier Momenten des Spiegelbildkonflikts.
(...)
Das mythische Modell der destruktiven Eigenliebe liefert die Grundstruktur des Zusammenspiels von Sehnsucht und Aggression, die in allen narzisstisch-imaginären Operationen anzutreffen ist. Das Spiegel-Selbst - ein narzisstisches Ideal-Ich mit den Attributen der Ganzheit und Kontinuität - erscheint unter zwei Aspekten, die schlechthin unvereinbar sind und als solche die unaufhebbare Spannung der imaginären Beziehung begründen: zum einen als Bürge der eigenen Identität - mehr noch: als diese Identität an sich; zum anderen als ein Fremdes, als ein im Realen unerreichbares Anderes, getrennt durch eine fundamentale Differenz, die jede Identifikation ausschließt. Auf diese Weise gelangt das Subjekt in eine prekäre Rivalität zum Ideal-Ich, welches doch, als Wunschbild narzisstischer Allmacht, seine Stabilität und Einheit gewährleisten soll. Das Ideal-Ich wird durch seinen absolutistischen Anspruch letztlich zur Quelle des Hasses, oder, unmetaphorisch formuliert: zu dessen konstitutiver Bedingung. Die aus der imaginären Situation notwendig resultierende Dialektik von Anziehung und Abstoßung führt so die Dimensionen der Begierde und des Hasses in die Subjektivität ein.
(...)
Der Eintritt in die Symbolische Ordnung
War beim primären Bedürfnis und dessen halluzinatorischem Erfüllungsmodus die unmittelbare Erfüllung - gleich ob real oder fiktiv - das eigentliche Triebziel, so differenziert sich dieses auf der höheren Stufe zu einem unbedingten Anspruch auf mütterliche Präsenz. Natürlich ist der Wunsch nach realer Bedürfnisbefriedigung immer noch die treibende Kraft hinter dieser komplexeren Struktur. Indes hat das Kind bereits einen größeren Teil der Umweltkomplexität kognitiv erfasst und seinem Bewusstseinshorizont assimiliert: es hat gelernt, die Präsenz der Bezugsperson von ihrer Absenz zu unterscheiden und durch anspruchssignalisierende Äußerungen einzufordern, und dies, sofern das Bedürfnis auftritt, in aller Unbedingtheit. Die in ihrer unbedingten Präsenz gewünschte Person wird zum Garanten der eigenen narzisstischen Unversehrtheit, zum Objekt eines Anspruchs auf liebevolle Zuwendung und so zum Spender einer doppelbödigen Liebe, die zunehmend imaginäre Züge trägt. Was sich der Unbedingtheit des Liebesanspruchs an die Mutter schließlich entgegenstellt und entgegenstellen muss, ist die Symbolische Ordnung, die den imaginären Absolutismus in eine dritte und noch höhere Struktur integriert: in die Dimension der symbolisch vermittelten Intersubjektivität, die conditio sine qua non der menschlichen Kulturevolution.
Als Medium dieser Vermittlung tritt, folgt man Lacan, der Vater in Funktion, er ist die Schaltstelle, an der das soziale Gesetz, ein gänzlich immaterielles Abstraktum, transformiert wird in psychische Struktur, in unbewusstes Subjekt-Sein. Nun entsteht endgültig jenes Subjekt, von dem Lacan behauptet, es sei, anders als das moi des schönen oder auch weniger schönen Selbstbetrugs, die eigentliche Quelle der subjektiven Aktivitäten. Um es gleich vorwegzunehmen: nicht der konkrete Vater ist per se der Initiator der kleinkindlichen Subjektbildung, denn er ist selbst nur ein historisches Produkt vorgängiger symbolischer Prozesse; als Repräsentant der väterlichen Funktion im ödipalen Dreieck vermag er aber die Position im intersubjektiven Netz einzunehmen, von der aus die Macht des Symbolischen auf den imaginären Absolutismus des Kindes negierend und strukturierend - in Lacans dramatischer Terminologie: kastrierend - einwirkt. Das Verhältnis des konkret-kontingenten Vaters zu seiner sozial vorgegebenen symbolischen Funktion kann mit einem wichtigen Ausdruck des Lacanschen Denkens als imaginäre Verdopplung der symbolischen Position verstanden werden.
lässt sich die Vaterfigur als die Instanz begreifen, welche den Strukturierungsprozess dynamisiert, so liefert die Sprache - im Sinne der langue Saussures - das strukturale und formale Moment dieses Prozesses, der zur unbewussten Subjektbildung führt.
Über den Effekt dieses Prozesses führt Lacan aus: „Die Sprachwirkung ist die ins Subjekt eingeführte Ursache. Vermöge dieser Wirkung ist dieses nicht Ursache seiner selbst; es trägt nur den Wurm der Ursache in sich, der es spaltet. Seine Ursache nämlich ist der Signifikant, ohne den kein Subjekt im Realen wäre.“ Was das unbewusste Subjekt also konstituiert, ist das System von Signifikanten und deren Differenzen rein in ihrer Formalität unter Absehung von jedem Signifikat - hier fließt Sausseres Synchroniedenken und Lévi-Strauss` Strukturbegriff ein -, welches von Lacan unter dem Begriff des Signifikanten vereinfachend subsumiert wird. Die fundamentale Bedeutsamkeit dieses Prozesses kann gar nicht überschätzt werden: „Dieses Erleiden, diese Passion des Signifikanten wird von da her zu einer neuen Dimension der Conditio humana: sofern nämlich nicht einfach der Mensch spricht, sondern Es in dem Menschen und durch den Menschen spricht; sofern seine Natur eingewoben ist in Wirkungen, in denen die Struktur der Sprache, zu deren Material er wird, wieder auftaucht, und sofern damit die Relation des Sprechens in ihm Resonanz findet, jenseits von allem, was dem Vorstellungsvermögen der Vorstellungspsychologie zugänglich ist.“
Der zuvor verwendete Term der Ursache (frz. cause) zeigt bereits, dass für Lacan der tiefste Seinsgrund der Subjektivität ineins fällt mit der symbolischen Struktur als reine Form; insofern man also dem unbewussten Subjekt - wenn schon nicht dem bewussten - Substanz zuschreiben wollte (eine Überlegung, die aufgrund der hier vertretenen Auffassung von der Irrigkeit des Substanzdenkens rein spielerisch ist), wäre diese gleichbedeutend mit der formalen Struktur des Sprachlichen. Für Lacan stellt sich jedoch die Frage, wie sich Subjektivität und Intersubjektivität gemeinsam denken lassen, ohne Subjektivität mit der symbolischen Ordnung vollständig identifizieren zu müssen. Seine Antwort indiziert eine seltsamen Status der Subjektivität, die zur differentiellen Signifikantenstruktur, die nunmehr die Form des Unbewussten ausmacht, in einem vexierbildartigen Verhältnis steht: das Subjekt hat die Seinsweise des Strukturalen und ist doch etwas anderes als dieses Strukturale, eine amorphe Kraft, die sich im Strukturalen nur äußert. In Lacans Worten: „Sprachwirkung darin, dass es aus diesem ursprünglichen Spalten [durch die strukturale Sprachordnung] entsteht, übersetzt das Subjekt eine signifikante Synchronie in jene ursprüngliche zeitliche Schwingung, die das konstituierende fading seiner Identifizierung darstellt.“ Dabei sind es die von Jakobson hervorgehobenen sprachlichen Operationen der Metapher und der Metonymie, in denen das Subjekt sich artikuliert und damit die synchrone, also zeitlose Struktur in zeitliches Dasein transformiert. So schreibt Lacan, dass „die [im vorletzten Zitat] zitierten Wirkungen wiedergefunden werden sollen in jenen Gesetzen, die den anderen ‘Schauplatz’ beherrschen, den Freud in bezug auf die Träume als Ort des Unbewussten bezeichnet hat, die Wirkungen, die offenbar werden auf der Ebene jener Kette aus materiell instabilen Elementen, die die Sprache konstituiert, und die determiniert sind durch jenes doppelte Spiel von Kombination und Substitution im Signifikanten nach den zwei Abhängen (versants), die das Signifikat erzeugen: Metonymie und Metapher, jene Wirkungen also, die bestimmt sind für die Einsetzung des Subjekts.“
Diese Struktur des menschlichen Unbewussten ergibt sich als Effekt einer spezifischen, der ödipalen Dynamik, die Freud mit seiner Theorie des Ödipuskomplexes vorgezeichnet hatte und die von Lacan noch radikaler ausformuliert wird. Die im Verlaufe der ödipalen Krise sich in den Vordergrund schiebenden Motive des Eltern-Kind-Dramas sind der Inzestwunsch gegenüber dem gegengeschlechtlichen Elternteil und der Wunsch nach dem Tod des Vaters, beides Bestrebungen, die dem Gesetz des Sozialen und damit dem Sozialen ‘an sich’ diametral zuwiderlaufen. Dieses Gesetz gründet ja gerade auf der Tabuisierung von Inzest und Vatermord, was Freud schon hinreichend erkannte und von Lévi-Strauss in seiner Verwandtschaftstheorie (in bezug auf das Inzestverbot) detailliert weitergedacht wurde. Beide Tabus sind konstitutiv für die Bildung und Reproduktion menschlicher Gemeinschaft: das Inzestverbot ist Quelle sozialer Strukturbildung und -kohärenz, das Tötungsverbot ist Garant einer verbindlichen moralischen Ordnung, die jedes Subjekt in das immaterielle Positionengefüge der Gemeinschaft einbindet. Erst die Unterwerfung unter das Gesetz konstituiert das Subjekt als „Unterworfenes“ vollständig.
Zum Thema ´Lacan und Affekte´ siehe:
http://www.turia.at/pdf/Evans_S27-38.pdf
What Does Lacan Say About… Affects? | LACANONLINE.COM
Zuletzt bearbeitet: